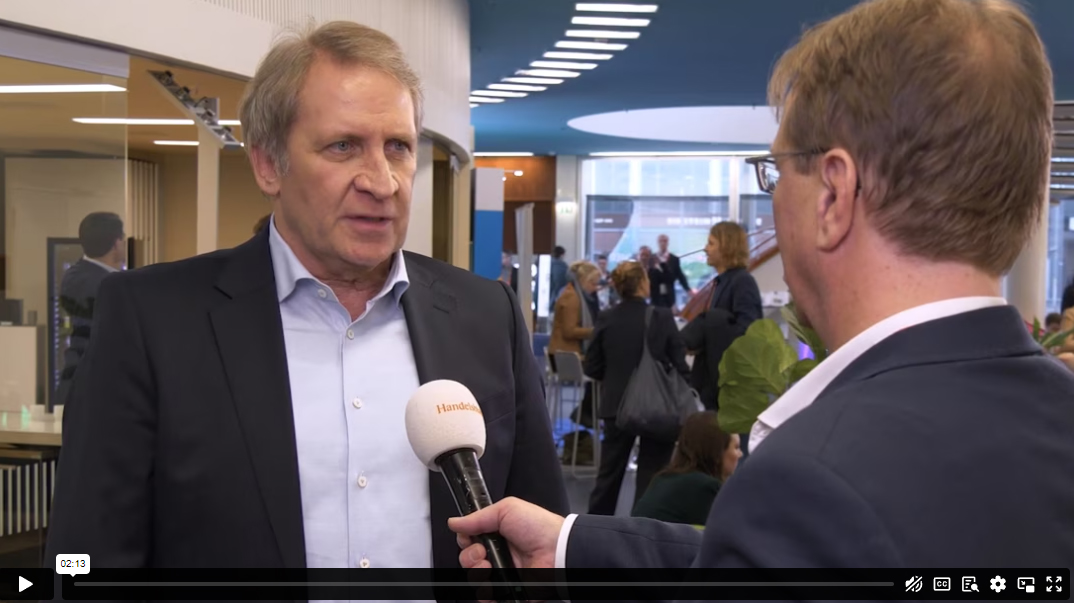Viel Aufbruch, viel Kontroverse und viel positive Energie. Kontrovers wurde das Thema Industriestandort Deutschland angesichts hoher Strompreise und langwieriger Genehmigungsverfahren diskutiert. Hoffnung machte generative KI als Enabler der Energiewende.
zur Bildergalerie


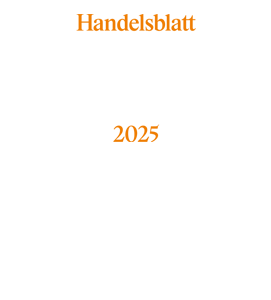
Raus aus dem Krisenmodus:
wie die Energiewende zum Erfolg wird
Energiewende und zwar jetzt. Wir müssen raus aus dem Krisenmodus und aktiv die Energiewende vorantreiben. Welche Faktoren tragen zu einer erfolgreichen Energiewende bei? Sind wir auf dem richtigen Weg? Wie gehen andere Länder voran?
Unter dem Motto „Raus aus dem Krisenmodus: wie die Energiewende zum Erfolg wird“ bringen wir beim Handelsblatt Energie-Gipfel die entscheidenden Köpfe aus Politik, Energie und Startup zusammen, um die Weichen für den nachhaltigen Umbau des Energiesystems zu stellen.
Wir bieten Ihnen unabhängige Informationen, konkrete Best Practice und die richtigen Kontakte, damit Sie zu Jahresbeginn Ihre Strategie zukunftssicher machen können.
Kevin Knitterscheidt, Ressortleiter Podcast, Live & Video, Handelsblatt
Themen 2025
Rein in die Zukunft – Strategien für eine erfolgreiche Energiewende:
- Energiewende global: Wie gehen andere Länder voran? Was können wir von Ihnen lernen?
- Gemeinsam Europas Energie sichern: Versorgungssicherheit, Netze, Dekarbonisierung
- Regulatorische Rahmenbedingungen, Finanzierung und Umsetzung der Energiewende
- Jobmotor Energiewende vs. Deindustrialisierung
Technologische Innovationen für eine zukunftsfähige Energiebranche:
- Einsatz von KI und Gen AI-Anwendungen: Googelst du noch, oder promptest du schon?
- Digitaler Zwilling, Smart Grid
Erfolgsfaktor Carbon Management – Aufbau von Wertschöpfungsketten für CCS
- Bedeutung / Auswirkungen der Carbon Management Strategie
- Carbon Management: Lösungen und Best Practice: Von anderen lernen
- Start-Ups, die CO2 einsparen, speichern oder aus der Luft filtern
Industriestandort Deutschland – Energiekosten als dezentraler Wettbewerbsfaktor für die Industrie
- Kosten für die Energiewende: Wer bezahlt’s?
- CO2-Emisionen einsparen: Strom statt Sprit, Wärmepumpen statt Gas, Prozesselektrifizierung
- Industriestrompreis
Erneuerbare Energien:
- Wind
- Solar
- Alternative Erneuerbare Energien: Geothermie, Flusswärmepumpe, etc.
Wasserstoff-Markthochlauf: Sind wir in der Poleposition?
- Wasserstoff-Strategie
- Ausbau des Wasserstoff-Kernnetzes / Wasserstoff im Verteilnetz
- Kritische Bilanz: sind wir in der Poleposition oder reicht es am Ende doch nicht für die Industrie?
Eine neue Energie-Infrastruktur für Deutschland:
- Netzausbau: Steigerung der quantitativen Übertragungsqualitäten
- Neues Finanzierungskonzept für Netze: Wie viel Geld sollte der Staat für die Übertragungsnetze ausgeben?
- Stadtwerk: Wie resilient sind die lokalen Stromnetze?
- Gasverteilnetze: Abschalten, Rückbau oder Umnutzung für H2?
Änderungen vorbehalten. Weitere Themen in Abstimmung.
Rückblick Energie-Gipfel 2024
Impressionen 2024
Moleküle für die Energiewende
Wir stehen vor einer gewaltigen Herausforderung: Die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Soll der Fokus auf (grünen) Wasserstoff gelegt werden oder auf klimaneutrales Gas? Klar ist, ohne Moleküle wird es nicht gehen. Aber wie sieht ein guter Energiemix zukünftig aus? Und wie steht es um die Integration der erneuerbaren Energien? Wie schnell gelingt der Umbau in eine erneuerbare, dezentrale und grüne Energie-Welt?
Frühbuchertickets
Ticketpreise
Tickets für Energieversorger/Industrieunternehmen 2500€
Datum und Uhrzeit
Dienstag, 21.01.2025, 09:00 Uhr –Donnerstag, 23.01.2025, 17:00 Uhr zum Kalender hinzufügen
Veranstaltungsorte:
21. und 22.01.2025
bcc Berlin Congress Center
Alexanderstr. 11
10178 Berlin
23.01.2025
Soho House Berlin
Torstraße 1
10119 Berlin